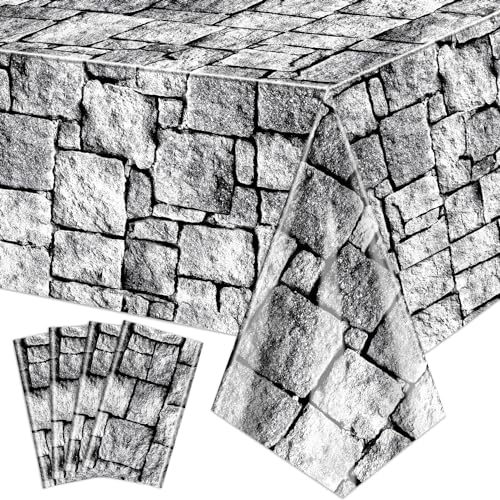Ellaria
Well-known member
Hallo allerseits, wie in meinem Vorstellungsthread bereits angedroht, schwirren mir immer noch einige Detailfragen im Kopf herum, die ich hier gerne diskutieren würde. Geplant habe ich ein Kleid (2. Schicht; über dem Leinenunterkleid) einer etwas besser betuchten Stadtbewohnerin aus Oberfranken, ca. 1350-1370. Dafür habe ich einen dunkelgrünen Wollstoff gekauft (farblich natürlich nicht ganz optimal, aber er war deutlich günstiger als die Alternativen von Naturtuche - zum Experimentieren und um damit vielleicht mal über den GroMi-Markt zu laufen muss er reichen). Auch wenn der Stoff noch recht weit davon entfernt ist historisch korrekt zu sein, der Schnitt und die Verarbeitung sollen möglichst nah ran kommen. Und damit das auch was wird, frage ich vorsichtshalber mal die Experten (also euch)  . 1. Der Schnitt: Herjolfsnes vs. Viertelschnitt Ich tendiere momentan zum Viertelschnitt, weil ich wahrscheinlich nur so ein Kleid hinbekomme, das an der Taille und am unteren Rücken so eng anliegt wie ich mir das vorstelle. Ich will zwar kein Kleid, das den Körper formt (dafür bin ich zu früh angesiedelt), aber es sollte schon so eng sein wie z.B. die Kleider in der Regensburger Weltchronik (ca. 1360). Das Problem ist nur, dass ich außer den auf Abbildungen eng dargestellten Kleidern keinen direkten Beleg für diese Schnittform zu meiner Zeit finden kann. Das einzige erhaltene Kleidungsstück ist das Goldene Kleid der Königin Margareta (Anfang 15. Jh.). In der Männermode scheint der Schnitt allerdings schon existiert zu haben, die Frage ist nur, wann er auf die Frauenmode übertragen wurde und wann er in meiner Gegend bekannt wurde. Fallen jemandem dazu noch weitere Anhaltspunkte ein? Kritik? Alternativvorschläge? Ich bin für alles offen :/ . 2. Mittelgeren: Ja oder Nein? Die Verwendung von Mittelgeren habe ich eigentlich nie angezweifelt - bis ich das Buch von Katrin Kania gelesen habe. Ich teile ihre Ansicht, dass Mittelgeren bei Frauenkleider generell eher nicht verwendet wurden allerdings nicht, weil ich doch einige Belege dafür gefunden habe. Wenn ich Kleider, die mit Mittelgeren geschneidert sind, mit diversen Abbildungen vergleiche, kommt das optisch auch ganz gut hin. Trotzdem würde es mich interessieren, ob Darstellerinnen aus meinem Zeitraum schon mal Kleider ohne Mittelgeren zum Vergleich geschneidert haben. Kommt der Fall von Kleidern ohne Mittelgeren vielleicht doch noch näher an die Abbildungen heran? 3. Das Dilemma mit dem Verschluss Ursprünglich wollte ich Knöpfe – sind hübsch, sieht man bei anderen Darstellern immer wieder. Dann hat mich die Betreiberin der Seite La Cotte Simple verunsichert und meine eigene Suche nach Belegen für Knöpfe an der zweiten Kleiderschicht (nicht an der Surcote) war leider auch nicht sehr erfolgreich. In Manuskripten ist für gewöhnlich gar kein Verschluss abgebildet und bei Grabmälern tragen die Damen meist eine dritte Schicht Kleidung. Grabmäler ein klein wenig (bis deutlich) nach meinem Darstellungszeitraum zeigen Frontschnürungen, in einer Weltchronik von 1370 befindet sich genau eine Abbildung einer Frontschnürung (später findet man diese öfter). Der einzige recht eindeutige Beleg für Knöpfe an der Front sind Grabmäler aus der Schweiz von 1390. Bei Männerkleidung finde ich für meine Zeit Belege für sowohl Knöpfe als auch Schnürung (letzteres eher selten). Und nun? Waren Schnürungen zu meiner Zeit schon verbreitet genug? Gab es doch Knöpfe an Frauenkleidern? Ich bin wirklich kurz vorm Verzweifeln… Ohje, das ist jetzt ziemlich lang geworden, ich bin jedem dankbar, der überhaupt alles gelesen hat :knuddel . Mir ist natürlich klar, dass mir hier niemand eine Absolution erteilen kann (schön wär’s…). Ich freue mich aber über jede Anregung, sei es zu weiteren Quellen, Interpretationsmöglichkeiten, auf die ich nicht gekommen bin oder was auch immer euch sonst noch einfällt. Falls jemand an meinen nicht aufgelisteten Belegen interessiert ist, schicke ich gerne eine PN. Liebe Grüße Ellaria
. 1. Der Schnitt: Herjolfsnes vs. Viertelschnitt Ich tendiere momentan zum Viertelschnitt, weil ich wahrscheinlich nur so ein Kleid hinbekomme, das an der Taille und am unteren Rücken so eng anliegt wie ich mir das vorstelle. Ich will zwar kein Kleid, das den Körper formt (dafür bin ich zu früh angesiedelt), aber es sollte schon so eng sein wie z.B. die Kleider in der Regensburger Weltchronik (ca. 1360). Das Problem ist nur, dass ich außer den auf Abbildungen eng dargestellten Kleidern keinen direkten Beleg für diese Schnittform zu meiner Zeit finden kann. Das einzige erhaltene Kleidungsstück ist das Goldene Kleid der Königin Margareta (Anfang 15. Jh.). In der Männermode scheint der Schnitt allerdings schon existiert zu haben, die Frage ist nur, wann er auf die Frauenmode übertragen wurde und wann er in meiner Gegend bekannt wurde. Fallen jemandem dazu noch weitere Anhaltspunkte ein? Kritik? Alternativvorschläge? Ich bin für alles offen :/ . 2. Mittelgeren: Ja oder Nein? Die Verwendung von Mittelgeren habe ich eigentlich nie angezweifelt - bis ich das Buch von Katrin Kania gelesen habe. Ich teile ihre Ansicht, dass Mittelgeren bei Frauenkleider generell eher nicht verwendet wurden allerdings nicht, weil ich doch einige Belege dafür gefunden habe. Wenn ich Kleider, die mit Mittelgeren geschneidert sind, mit diversen Abbildungen vergleiche, kommt das optisch auch ganz gut hin. Trotzdem würde es mich interessieren, ob Darstellerinnen aus meinem Zeitraum schon mal Kleider ohne Mittelgeren zum Vergleich geschneidert haben. Kommt der Fall von Kleidern ohne Mittelgeren vielleicht doch noch näher an die Abbildungen heran? 3. Das Dilemma mit dem Verschluss Ursprünglich wollte ich Knöpfe – sind hübsch, sieht man bei anderen Darstellern immer wieder. Dann hat mich die Betreiberin der Seite La Cotte Simple verunsichert und meine eigene Suche nach Belegen für Knöpfe an der zweiten Kleiderschicht (nicht an der Surcote) war leider auch nicht sehr erfolgreich. In Manuskripten ist für gewöhnlich gar kein Verschluss abgebildet und bei Grabmälern tragen die Damen meist eine dritte Schicht Kleidung. Grabmäler ein klein wenig (bis deutlich) nach meinem Darstellungszeitraum zeigen Frontschnürungen, in einer Weltchronik von 1370 befindet sich genau eine Abbildung einer Frontschnürung (später findet man diese öfter). Der einzige recht eindeutige Beleg für Knöpfe an der Front sind Grabmäler aus der Schweiz von 1390. Bei Männerkleidung finde ich für meine Zeit Belege für sowohl Knöpfe als auch Schnürung (letzteres eher selten). Und nun? Waren Schnürungen zu meiner Zeit schon verbreitet genug? Gab es doch Knöpfe an Frauenkleidern? Ich bin wirklich kurz vorm Verzweifeln… Ohje, das ist jetzt ziemlich lang geworden, ich bin jedem dankbar, der überhaupt alles gelesen hat :knuddel . Mir ist natürlich klar, dass mir hier niemand eine Absolution erteilen kann (schön wär’s…). Ich freue mich aber über jede Anregung, sei es zu weiteren Quellen, Interpretationsmöglichkeiten, auf die ich nicht gekommen bin oder was auch immer euch sonst noch einfällt. Falls jemand an meinen nicht aufgelisteten Belegen interessiert ist, schicke ich gerne eine PN. Liebe Grüße Ellaria

























![XUANPAI Nordischer Wikinger Schmuck Nordisches Armband für Männer Schutzamulett Mobius Armreifen Valknut Vikinger Talisman Armband Geburtstagsgeschenk]](https://m.media-amazon.com/images/I/31tuQkMNiML._SL500_.jpg)